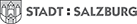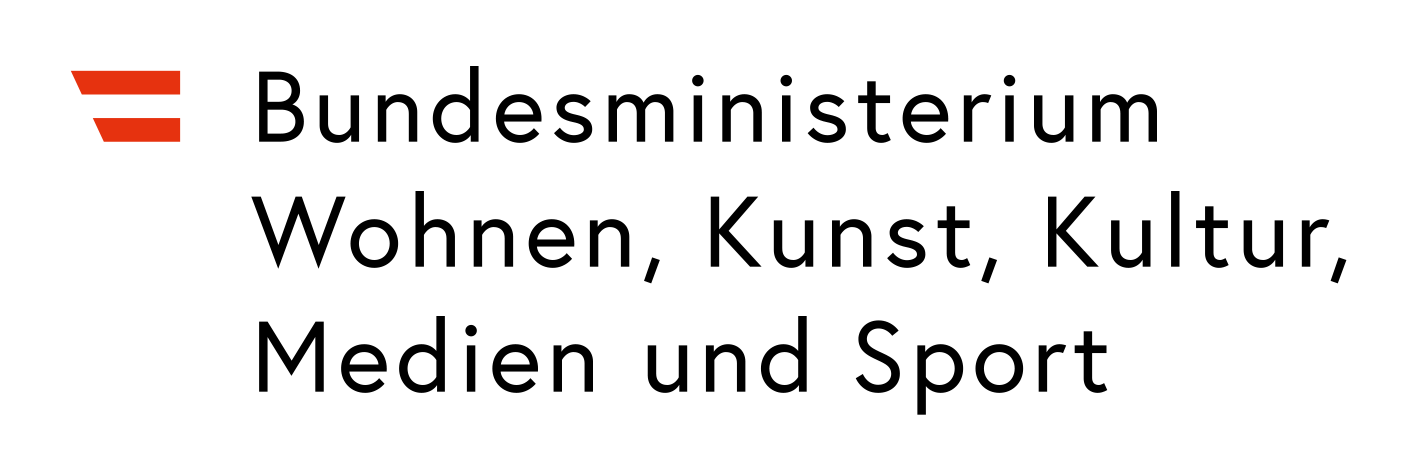Die letzte Ausstellung des Jahres ist traditionell den Mitgliedern des Kunstvereins vorbehalten und wird in diesem Jahr von Hana Ostan-Ožbolt-Haas kuratiert. Die Künstler:innen wurden im Rahmen einer internationalen Ausschreibung ausgewählt.
Debt
Jahresausstellung der Mitglieder des Salzburger Kunstvereins 2024/2025
14. Dezember 2024 – 16. Februar 2025
Eröffnung: Freitag, 13. Dezember 2024, 20 Uhr
Schuld
Text von Hana Ostan-Ožbolt-Haas
Zurückzahlen ist eine Pflicht, aber verleihen ist eine Option?
Ein Mann kann sicherlich seine Schulden einfordern:
Aber wenn es Geld zu leihen gibt,
muss der Mensch wählen dürfen
Die Zeit zu wählen, die ihm genehm ist![1]
So lautet eine Passage aus Lewis Carrolls Gedicht Peter und Paul – eine lange, gereimte Erzählung über zwei Figuren, die durch Schulden miteinander verbunden sind. Dieser vielschichtige Begriff und das umfassende Konzept können aus verschiedenen Perspektiven betrachtet werden, einschließlich seiner emotionalen, sozialen, historischen und wirtschaftlichen Dimensionen.
Was ist Schuld in ihrem grundlegendsten Sinne?
Ein Versprechen der Rückzahlung. Die Konzepte von Versprechen und Wert stehen im Mittelpunkt der Beziehung zwischen Gläubiger und Schuldner. Friedrich Nietzsche beschreibt diese Beziehung als „die älteste und persönlichste Beziehung, die es gibt“ – eine Beziehung, in der „der Mensch dem Menschen zum ersten Mal begegnete und sich mit dem Menschen maß“.[2] Nach Nietzsche besteht die wesentliche Aufgabe einer Gemeinschaft oder Gesellschaft darin, Individuen hervorzubringen, die Versprechen machen können – solche, die innerhalb der Gläubiger-Schuldner-Dynamik für sich selbst bürgen und in der Lage sind, ihre Schulden zu erfüllen. Dies erfordert den Aufbau eines Gedächtnisses im Individuum, das die Fähigkeit sichert, Versprechen zu halten. Ein solches Gedächtnis umfasst die Entwicklung eines Gewissens. Im Bereich der Schuldverpflichtungen, so Nietzsche, nimmt die Subjektivität also Gestalt an.
Schuld ist eng mit Zeitlichkeit verbunden: Wer ein Versprechen einhält, übernimmt die Rolle, für seine Zukunft verantwortlich zu sein – eine Zukunft, die immer unvorhersehbar ist, egal wie nah oder fern sie ist. Wenn Schuld auf das Abwesende – das, was nicht ist – verweist, trägt sie zugleich eine Potenzialität – das, was sein könnte – in sich: Die dem Mangel innewohnende Unzulänglichkeit birgt ein aktives Potenzial, das sich sowohl durch Möglichkeiten als auch durch Unmöglichkeiten entfaltet. Es waren genau solche Möglichkeiten, die mich bei der Auswahl der Künstler:innen und ihrer Werke für die Ausstellung interessierten.
Was ist Schuld?
Eine „Perversion eines Versprechens“, so David Graeber.[3] Die moderne Gesellschaft wird von Versprechen geprägt – Versprechen von Sicherheit, Gemeinschaft und Fürsorge – und wird gleichzeitig oft von wirtschaftlichen Verträgen, historischen Ungerechtigkeiten und gesellschaftlichen Erwartungen bestimmt. Der wirtschaftliche Aspekt der Schuld – die finanzielle Verschuldung – ist für viele, die unter den prekären Bedingungen der Kunstwelt arbeiten, eine unausweichliche, alltägliche Realität: für diejenigen, die von einem Honorar und Auftrag zum nächsten leben und kaum über Null bleiben. Wer also ist privilegiert genug, Teil eines Systems zu sein, das so klassenbasiert ist?
In Anbetracht sinkender Löhne und einer weitgehend auf das spätere Leben verschobenen Rente wurden der Zugang zu Krediten und persönlichen Investitionsportfolios als ein Instrument vorgeschlagen – als eine Form der Investition in das Selbst –, mit der sich die veränderten sozialen und wirtschaftlichen Bedingungen ausgleichen lassen. Das Recht auf (höhere) Bildung, Wohnraum, Formen des sozialen Schutzes und soziale Dienstleistungen wurde als Privileg neu definiert, das von der Annahme von Krediten und privaten Versicherungen abhängig ist. Schulden sind daher ein Mechanismus, der untrennbar mit Kontrolle und Disziplinierung verbunden ist – sie organisieren das soziale Leben und verstärken die Ausbeutungs- und Herrschaftsmechanismen zwischen den Eigentümern (des Kapitals) und den Nichteigentümern (des Kapitals). Darüber hinaus bildet die Defizitfinanzierung (Deficit Spending) die Grundlage aller modernen Nationalstaaten.[4]
Schuld ist ein so aufgeladenes Wort, da es im Bereich der Moral angesiedelt ist und sich zwischen Verantwortlichkeiten, Verpflichtungen und Schuldgefühlen bewegt. Sowohl Verpflichtung als auch Schuld, als „die gemeinsame Bedingung derer, die das Gefühl haben, in der Schuld zu stehen“, können laut Nietzsche auf die sehr materialistische Idee der Schuld selbst zurückgeführt werden.[5] Es ist das deutsche Wort „Schuld“, das diese Dualität einfängt und beide Bedeutungen umfasst: Der moralische Begriff der Schuld (Schuldgefühl / guilt) hat seinen Ursprung in der greifbaren Vorstellung von Schulden (debts).
Als Kuratorin der Mitgliederausstellung stieß ich auf eine deutliche Asymmetrie zwischen mir und den fast dreihundert Künstler:innen, die sich auf die offene Ausschreibung beworben hatten.[6]
Symbolisch gesehen steht Schuld für jede Form von Ungleichgewicht.
Inwieweit kann man also sagen, dass der Begriff der Schuld das Wesentliche ist?
Ontologische Schuld bedeutet eine fundamentale Verschuldung, die dem Wesen der menschlichen Existenz inhärent ist (wir schulden und werden gleichzeitig etwas geschuldet); sie entsteht bereits durch den Akt der Geburt in die Welt. Dabei ist unsere Existenz nicht selbstgenügsam, sondern wird durch verschiedene – familiäre, soziale, kulturelle und ökologische – wechselseitige Beziehungen geprägt und aufrechterhalten. Bei Schulden geht es also auch um die Anerkennung der Beiträge vergangener Generationen und der gegenseitigen Abhängigkeiten mit denen, die noch kommen werden.
Zwischen der Zerbrechlichkeit und der Hartnäckigkeit der (Macht-) Strukturen, die uns zusammenhalten, reagiert die Ausstellung auf das Thema in materieller – größtenteils skulpturaler, mit einer Vielzahl von Materialien und Ansätzen – sowie schriftlicher und gesprochener Form. Performative Lesungen von zwei Künstler:innen im Rahmen der Eröffnungsveranstaltung und an einem weiteren Abend im Verlauf der Ausstellung sind integraler Bestandteil der Erzählung der Ausstellung.
Künstler:innen: Gleb Amankulov, Benjamin Hirte, David L. Johnson, Tammy Langhinrichs, Artur Schernthaner-Lourdesamy, Miriam Stoney, Magdalena Stückler, Frank Wasser
Kuratorin: Hana Ostan-Ožbolt-Haas
Mit großzügiger Unterstützung von Tectus Risk Management, der Galerie Thaddaeus Ropac Salzburg und des Slowenischen Kulturinformationszentrum Wien.
Hana Ostan-Ožbolt-Haas (sie/ihr, geb. in Slowenien) ist Kunsthistorikerin, unabhängige Kuratorin, und Autorin.Von 2019 bis 2023 war sie Direktorin der ULAY Foundation, wo sie für verschiedene (kuratorische) Projekte im Zusammenhang mit dem Nachlass des Künstlers verantwortlich war. Eine Auswahl ihrer jüngsten kuratorischen Projekte umfasst Ausstellungen bei SOPHIE TAPPEINER (Wien, 2024), Gregor Podnar (Wien, 2024), Schauraum MuseumsQuartier Wien (Wien, 2023/2024), Sector Gallery 1 (Bukarest, 2023), Eva Kahan Foundation (Wien, 2023), HOW Art Museum (Shanghai, 2022/2023), Georg Kargl Fine Arts im Rahmen des Curated by Festivals (Wien, 2022) und Stedelijk Museum (Amsterdam, 2020/2021). Ostan-Ožbolt-Haas schreibt für Artforum und ihre Texte wurden in Frieze und ArtReview veröffentlicht. Bis vor kurzem hatte sie eine Gastprofessur an der Angewandten, Universität für angewandte Kunst Wien. Sie lebt und arbeitet in Wien.
Bild ganz oben: Gleb Amankulov, Cover, 2024, courtesy of the artist. Foto: kunst-dokumentation
Fußnoten:
[1] Das Gedicht „Peter und Paul“ in Kapitel 11 von Lewis Carrolls Roman Sylvie und Bruno (1889) kontrastiert ein skurriles Märchen mit einem ernsthaften sozialen Kommentar. Die Charaktere führen Diskussionen über Religion, Philosophie und Moral im viktorianischen Großbritannien. Das Buch kann über das Projekt Gutenberg abgerufen werden: https://www.gutenberg.org/cache/epub/620/pg620-images.html.
[2] Friedrich Nietzsche, On the Genealogy of Morality and Other Writings (Cambridge: Cambridge University Press, 2006), 45.
[3] David Graeber, Debt: The First 5,000 Years (New York: Melville House, 2011), 391.
[4] Durch die öffentliche Verschuldung – die Höhe der Schulden, die Regierungen gegenüber externen (ausländischen Regierungen oder internationalen Finanzinstitutionen) oder inländischen Gläubigern haben - werden ganze Gesellschaften verschuldet. In Österreich scheint die Diskussion um den Umgang mit Staatsschulden und finanzieller Instabilität derzeit sehr präsent zu sein. Die Zeitung Der Standard berichtet im Oktober 2024 unter dem Titel „Zu hohe Schulden: Wie straft uns Europa, wenn wir auf die Regeln pfeifen?“ darüber, dass “Österreichs kommende Regierung jährlich zwischen zwei und drei Milliarden Euro konsolidieren muss, um die Vorgaben des EU-Schuldenpakts zu erfüllen. Wer die Regeln bricht, muss Strafe zahlen. Es gibt aber auch Schlupflöcher.“ https://www.derstandard.at/story/3000000240988/zu-hohe-schulden-wie-straft-uns-europa-wenn-wir-auf-die-regeln-pfeifen (17.10.2024)
[5] Elettra Stimilli, The Debt of the Living: Ascesis and Capitalism (New York: State University of New York Press, 2017), 138. Siehe auch Nietzsche, On the Genealogy of Morality, 161.
[6] Obwohl ich schon früher an Jurys teilgenommen hatte, war ich noch nie die einzige Person, die am Auswahlverfahren für eine offene Ausschreibung mit so vielen Bewerber:innen beteiligt war. Eine beträchtliche Anzahl von Künstler:innen reagierte auf meine Aufforderung zur Einreichung von Texten, in denen ich um eine kurze Antwort (maximal 150 Wörter, auf Englisch oder Deutsch) auf die Frage bat: „Wie steht die Bedeutung von Schulden – auf persönlicher oder gesellschaftlicher Ebene – im Zusammenhang mit Ihrer Arbeit?“ Die Künstler:innen lieferten aussagekräftige, intime Reflexionen, die mir viel Stoff zum Nachdenken boten und in gewisser Weise auch die Ausstellung einrahmten. Mein langwieriger Auswahlprozess war eine privilegierte Erfahrung, die jedoch von Gefühlen der Verantwortung und Schuld begleitet wurde, da ich wusste, dass ich 30 sehr unterschiedliche Ausstellungen zu diesem Thema hätte kuratieren können. Ich hoffe – und fühle mich in gewisser Weise verpflichtet –, dass sich aus dieser Erfahrung künftige Kooperationen ergeben werden, insbesondere mit den Künstler:innen, mit denen ich bei dieser Gelegenheit nicht zusammenarbeiten konnte. Die Künstler:innen, die sich beworben haben, haben ihre Zeit und ihre Ressourcen in ihre Bewerbungen investiert, wurden aber nicht ausgewählt, so dass sie sich in einem Zustand der Schuld und des Geschuldetseins befinden. Inwieweit bin ich ihnen etwas schuldig?